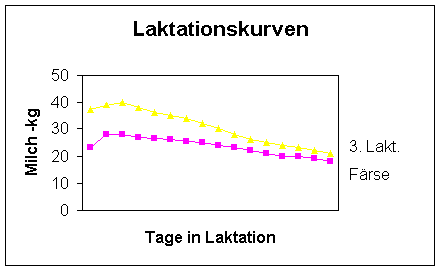
Holland und Dänemark als die Spitzenländer Europas in der Milchviehhaltung verfügen auch über ein modernes Datenbanksystem, was als einendes Element zwischen den verschiedenen Organisationen, Einrichtungen, Dienstleistern und Landwirten fungiert.
Grundsätzlich ist dort der Landwirt Besitzer seiner Betriebsdaten, egal wer sie erhoben hat. Und diese Daten sind für den Landwirt nur dann attraktiv, wenn sie auch auf der zentralen Datenbank zeitnah gespeichert und wiederzufinden sind.
Erst dadurch können, mittels intelligenter Datenauswertung über Verknüpfungen, Zuordnungen und Algorithmen, dem Landwirt bzw. seinem Berater Managementhilfen zur Verfügung gestellt werden, die das umfangreiche Zahlenmaterial auf punktuelle Aussagen konzentrieren.
Das gleiche Prinzip verfolgt der LKV Mecklenburg-Vorpommern bereits seit seiner Gründung. Erinnert sei hier nur an den Fütterungskontrollbericht mit der Ketose-Warnung oder seit einem Jahr die dynamische Fütterungskontrolle aus den Daten der Ablieferungsmilch. Hier setzte unser Landeskontrollverband Maßstäbe, die mit dazu beigetragen haben, daß die Milcherzeuger und Züchter Mecklenburg-Vorpommerns die Leistungsspitze in Deutschland mitbestimmen.
Doch die Herausforderung des europäischen Marktes stellt auch unsere Milchproduzenten vor immer höhere Aufgaben. Wir wollen dazu beitragen, daß unsere Mitglieder auch künftig durch bessere Managementhilfen und Informationen gewappnet sind.
Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, war die völlige Umstrukturierung der Datenverarbeitung nötig.
Gefördert mit Landes- und EU-Mitteln begann der LKV im Herbst 1998 mit dem Aufbau einer komplexen Rinderdatenbank nach den
dänischen und holländischen Erfahrungen.
Bei der Planung wurde neben einer hohen Leistungsfähigkeit auch die Kompatibilität zu anderen LKV’s berücksichtigt, um durch Konzentration der Programmierkapazität auch einen Zeitgewinn bei gleichzeitiger Minimierung der Kosten zu erzielen. Die erste Ausbaustufe trägt bereits konkrete Züge. Seit Mai 1999 wurden Teile des niederländischen Auswertungssystems (Betriebsstandardkuh, Laktationsleistung, Milchertrag, Laktationswert und Voraussage der nächsten MLP-Ergebnisse) in 74 Testbetrieben geprüft.
Die Erprobung wurde erfolgreich abgeschlossen, so daß ab sofort allen Milcherzeugern unseres Landes diese effektiven Managementwerkzeuge zur Verfügung stehen.
Was ist nun neu, warum hat der LKV Zeit und Geld investiert ?
1. Betriebsstandardkuh - ein exakter standardisierter Wert, der den Melkdurchschnitt ersetzt
2. Milchertrag - erstmalig wird die Milchleistung in Abhängigkeit von den Inhaltsstoffen finanziell in Euro bewertet
3. Laktationswert - Rangfolge der Kuh innerhalb der Herde nach ihrem Milchertrag
4. Zellzahlwert - korrigierter Wert der Eutergesundheit
Die Kosten für dieses exklusive Managementprogramm betragen 4 Cent Pro Kuh und Monat. Durch Einsparungen im Haushalt des LKV kann diese Auswertung für das Jahr 2005 allen Mitgliedern nur mit 2 Cent/Kuh in Rechnung gestellt werden.
Der künftige Ausbau der Rinderdatenbank wird auch wesentlich vom Engagement der teilnehmenden Einrichtungen und Organisationen sowie vom Landwirt selbst bestimmt. Schrittweise erfolgt die Einbindung weiterer Einrichtungen und Organisationen.
Parallel dazu wird die Internet-Anbindung aufgebaut, um Betrieben mit Netz-Zugang die Möglichkeit zu schaffen, über diesen Weg kostengünstig Informationen und Managementhilfen vom LKV zu beziehen.
Henning-Walter Prahl
Güstrow im Dezember 2004
Wie ist eine frischmelkende Färse am 40. Laktationstag mit einer Kuh in der 5. Laktation am 200. Laktationstag zu vergleichen ?
Die Lösung ist eine standardisierte, auf das Betriebsniveau bezogene Kuh, die Betriebsstandardkuh (BSK).
Der BSK ist ein errechneter Wert, ausgedrückt in kg Milch / Tag.
Alle Tiere eines Bestandes werden auf den 50. Laktationstag in der 3. Laktation ( 6.-7. Lebensjahr) mit einer Frühjahrskalbung (Februar / März)
hochgerechnet und sind so alle zu einem Stichtag (dem Tag der Milchleistungsprüfung) vergleichbar. Der Hochrechnung liegt die 305 - Tageleistung
der jeweiligen Herde zugrunde. Aus 2160 verschiedenen Laktationskurven errechnet sich der konkrete BSK - Wert. Dahinter stehen
Insgesamt stehen damit 28.080 Korrekturfaktoren zur Verfügung.
In Tabelle 1 wird der Umfang der einzelnen Korrekturfaktoren wiedergeben. Auf die Wiedergabe der Laktationsklassen wurde verzichtet.
Tabelle 1: Die Klasseneinteilung für das Herdenniveau, Abkalbealter und Kalbesaison
| Betriebs - niveau - klasse | gemittelte 305 - Tageleistung --------------------------------------------------------- Milch(kg) Fett(kg) Eiweiß(kg) |
Alters - klasse | Alter in Monaten | Saison - klasse | Monate | ||
| 1 | 1- 5650 | 1-251 | 1-195 | 1 | 21 | 1 | Dez / Jan |
| 2 | 5651-5829 | 252-258 | 196-201 | 2 | 22-23 | 2 | Feb / März |
| 3 | 5830-6008 | 259-265 | 202-207 | 3 | 24-25 | 3 | April / Mai |
| 4 | 6009-6188 | 266-272 | 208-213 | 4 | 26-27 | 4 | Juni / Juli |
| 5 | 6189-6367 | 273-279 | 214-219 | 5 | 28-29 | 5 | Aug / Sep |
| 6 | 6368-6546 | 280-286 | 220-225 | 6 | 30-31 | 6 | Okt / Nov |
| 7 | 6547-6725 | 287-293 | 226-231 | 7 | 32-34 | ||
| 8 | 6727-6905 | 294-299 | 232-238 | 8 | 35-36 | ||
| 9 | 6906-7084 | 300-306 | 239-244 | 9 | 37-38 | ||
| 10 | 7058-7263 | 307-313 | 245-250 | 10 | 39-40 | ||
| 11 | 7264-7443 | 314-320 | 251-256 | 11 | 41-42 | ||
| 12 | 7444-7622 | 321-327 | 257-262 | 12 | 43-44 | ||
| 13 | 7623-7801 | 328-334 | 263-268 | 13 | 45-50 | ||
| 14 | 7802-7981 | 335-341 | 269-274 | 14 | 51-56 | ||
| 15 | 7982-8160 | 342-348 | 275-280 | 15 | 57-68 | ||
| 16 | 8161-8339 | 349-355 | 281-286 | 16 | 69-92 | ||
| 17 | 8340-8518 | 356-362 | 287-293 | 17 | 93-104 | ||
| 18 | 8519-8698 | 363-369 | 294-299 | 18 | >=105 | ||
| 19 | 8699-8877 | 370-376 | 300-305 | ||||
| 20 | >=8878 | >=377 | >=306 | ||||
Ausgeschlossen von der Berechnung sind Tiere in der Kolostralperiode (diese Meßwerte sind ungültig) und über dem 250. Laktationstag. Ab diesem Zeitpunkt beeinflußt die Trächtigkeit die sichere Berechnung.
Die Aussagekraft des BSK hängt natürlich auch von der Anzahl der Tiere eines Bestandes ab. Je größer der Tierstapel, um so sicherer die Berechnungen, besonders die des Betriebsnievaus.
Ein Beispiel:
Eine Färse gibt zur Milchleistungskontrolle an ihrem 130. Laktationstag 30 kg Milch. Sie hat im Juli mit einem Erstkalbealter von 31 Monaten gekalbt.
Auf der Grundlage des Laktationsstadiums, der Kalbesaison, des Abkalbealters und des Betriebsniveaus errechnet sich für dieses Tier ein Korrekturfaktor von 1,49.
Der BSK - Wert beträgt danach 44,7 kg ( 30 kg Milch * 1,49 ) und liegt damit 49% höher als der gemessene Wert. Er entspricht der Leistung, die diese Färse
in der 3. Laktation am 50. Laktationstag bei einer Frühjahrskalbung in diesem Betrieb erzielen würde.
Die Betriebsstandardkuh ist somit ein Wert, der die laktationsbedingten Einflußfaktoren ausschließt (Alter, Laktationstag, Betriebsniveau, Abkalbemonat) und damit alle Tiere einer Herde untereinander vergleichbar macht. Dadurch können die Ursachen für Leistungsschwankungen der Herde, Gruppen und des Einzeltieres leichter aufgespürt werden.
Mögliche Einflüsse sind :
In Ergänzung zum Fütterungskontrollbericht ist damit auch das Ausmaß von Fütterungsfehlern nachweisbar.
Der Berechnungsalgorithmus für die Laktationsleistung ist relativ komplex, so daß auf eine ausführliche Darstellung verzichtet werden soll und nur die zum Verständnis notwendigen Grundsätze hier kurz dargelegt werden sollen.
Die 305 - Tage-Leistung ist eine Kennzahl, die geschaffen wurde, um Kühe mit unterschiedlichen Melktagen (Anzahl der Melktage in einer abgeschlossenen Laktation) vergleichen zu können. Es wurde der 305. Melktag (Laktationstag) als Stichtag festgelegt. Von Kühen mit längeren Melktagen als 305 wird die erbrachte Leistung nur 305 Tage berechnet, Kühe mit einer kürzeren Laktationszeit werden auf 305 Tage hochgerechnet mit Hilfe eines Gleichungssystems. Dies bezieht sich jedoch immer auf eine schon abgeschlossene Laktation ( Tier steht trocken) mit gemessenen Werten.
Wesentlich komplizierter ist die Berechnung der aktuellen Laktationsleistung in der laufenden Laktation.
Bekanntlich verläuft die Milchleistungskurve nicht gleichmäßig (Abb. 1).
Abbildung 1: Laktationskurven von Färsen und Altmelkern
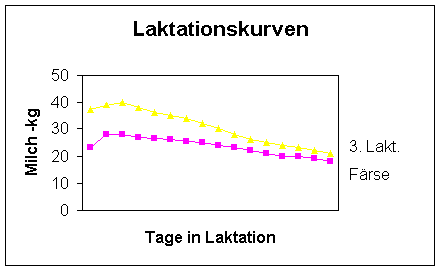
Die größten Differenzen treten im 1. Laktationsdrittel auf. Ältere Kühe produzieren in der 1. Hälfte der Laktation mehr Milch als Färsen. Auch der Abkalbemonat bestimmt den Kurvenverlauf. Kühe, die im Herbst abkalben haben einen gleichmäßigeren Kurvenverlauf als Frühjahrskalbinnen.
Die 305 - Tage - Produktion berechnet dynamisch über Interpolation (Berechnung eines Wertes zwischen zwei gemessenen Werten) unter Zuhilfenahme von Standard- Laktationskurven eine zu erwartende, hochgerechnete Laktationsleistung ( 305 Tage) in kg für Milch, Fett und Eiweiß (siehe auch Tabelle 1). So stehen 2160 Laktationskurven pro Merkmal (Milch, Fett und Eiweiß) zur Verfügung.
Der Milchertrag ist ein Wert, der sich aus dem Grundpreis für Milch errechnet, mit entsprechenden Zu-und Abschlägen für die Inhaltsstoffe Fett und Eiweiß und sich auf die geschätzte 305 - Tage - Produktion oder erzielte 305-Tage-Leistung bezieht. Die Berechnungsgleichung lautet :
NEKuh = w1*Y305Milch + w2*Y305Eiweiß + w3* Y305Fett
wobei
NEKuh= Milchertrag, basierend auf der 305 - Tage - Leistung
Y305Milch= 305 - Tage - Leistung Milch - kg korrigiert auf Alter und Kalbesaison
Y305Eiweiß= dasselbe für Fett - kg
Y305Fett= dasselbe für Eiweiß - kg
w1= Grundpreis für Milch (z.B. 0,25 Euro / l)
w2= Zu - bzw. Abschläge bei einem Basiswert Eiweiß (Basiswert 3,4 Zu-/Abschläge 0,048 Cent)
w3= Zu - bzw. Abschläge bei einem Basiswert Fett (Basiswert 3,7 Zu-/Abschläge 0,028 Cent)
Damit wird die Leistung des Tieres in Abhängigkeit von den Vereinbarungspreisen der Molkerei für Menge und Inhaltsstoffe finanziell bewertet.
Der Laktationswert ist ein Relativwert, der den Milchertragswert der Herde gleich 100 setzt und alle Abweichungen im NE der Einzeltiere von diesem Herdenwert prozentual bewertet. Danach bedeutet ein Laktationswert von 80 bei einer Kuh, daß sie 20% unter dem Leistungsdurchschnitt der Herde liegt.
LW = 100 * NEKuh / NEHerdendurchschnitt
Der Laktationswert ist eine Entscheidungshilfe,
Vor allen Dingen führt die regelmäßige Durchsicht und Selektion des Bestandes auch gleichzeitig zu seiner Ausgeglichenheit. Dies bringt vor allem große Vorteile bei der Fütterungstechnologie.
Hohe Zellzahlgehalte in der Milch attestieren verringerte Leistungsfähigkeit und Euterkrankheiten. Da der Zellzahlgehalt als
Konzentrationsangabe ( Tsd. Zellen / ml Milch) angegeben wird, verfälscht er das Bild, wenn man ein frischlaktierendes Tier mit einem
Tier im 280. Laktationstag vergleicht. Entscheidend für eine gesundheitliche Bewertung ist aber die Menge an somatischen Zellen,
die ein Tier ausscheidet. Bei einer reinen Konzentrationsangabe werden daher bei frischlaktierenden Tieren die somatischen Zellen zusammen
mit einer hohen Milchmenge ausgeschieden. Es tritt ein "Verdünnungseffekt" auf.
Weiterhin ist bekannt, daß Tiere mit zunehmendem Alter höhere Grundwerte aufweisen.
Um diese störenden Einflüsse bei einer gesundheitlichen Bewertung auszuschalten wurde der Zellzahlwert geschaffen.
Als Standard wird eine Färse mit einem gesunden Euter verwendet. Diese Standardfärse ist berechnet worden von allen Färsen, die innerhalb eines Jahres gekalbt haben und einen somatischen Zellgehalt unter 200 Tsd. / ml aufwiesen. Es wurde ein mittlerer Zellzahlgehalt von 71 Tsd. / ml bei einem Melkdurchschnitt von 21kg / Tag während der Laktation ermittelt.
Die Berechnung des Zellzahlwertes erfolgt nach folgender Rechnung (Formel 1):
ZW = 2 2log (x1 + y1) – 2log (xgem * yp)
wobei
x1 : gemessener Zellzahlgehalt *1000
x2 : gemessene Milchmenge kg
xgem : gemittelte Zellzahl bei Färsen mit gesundem Euter = 71
yp : gemittelte Milchmenge von Kühen per Parität
y1 = 21,0
y2 = 24,6
y3 = 26,2
Die obige Formel kann aufgelöst werden durch:
22log(x1 * y1 ) x1 *y1Die Korrekturfaktoren sind aus nachstehender Tabelle zu entnehmen:
| Status | bp |
| 1 | 0,0067069 |
| 2 | 0,0057264 |
| 3 | 0,0053758 |
Bei der Berechnung werden Zellzahlwerte >= 100 abgerundet auf 99
Beispiel:
| _ | Färse | Kuh, 5. Laktation | Kuh, 2. Laktation |
| Status | 1 | 3 | 2 |
| MLP - Milch (kg) | 27,0 | 27,2 | 17,2 |
| Zellgehalt (Tsd.) | 183 | 457 | 301 |
| ZW = | 0,0067069*27,0*183 | 0,0053758*27,0*457 | 0,0057264*17,2*301 |
| ZW = | 33 | 67 | 30 |
Der ZW ist somit ein Wert, der um die natürliche Zellausscheidung und die altersbedingte Mehrausscheidung korrigiert ist und
damit die klinisch wirklich interessanten Fälle deutlicher aufspürt.
Entsprechend der Abstufung erscheint rechnerisch ein Wert zwischen 1 und 99. Während Werte bis 20 eine gute Eutergesundheit
bescheinigen, sind Werte über 50 als bedenklich einzustufen.
Wie ist der ZW zu bewerten und welche Maßnahmen sind einzuleiten?
| Zellwert | Diagnose | Bewertung / Maßnahmen |
| 1 - 10 | ohne Befund | Tiergesund |
| 11 - 20 | normale Zellauscheidung | Euter leicht gereizt, nicht klinisch |
| 20 - 40 | erhöhter Zellbefund | Euter erkrankt - Behandlung einleiten |
| über 40 | schwere Mastitis> | Isolation, Behandlung, evt. frühzeitiges Trockenstellen - Merzung ?? |
Aufgrund der Zuordnung einer individuellen Standardkurve zu jedem Tier des Bestandes ist auch eine Voraussage der Ergebnisse der nächsten MLP möglich. Die Berechnung erfolgt an Hand der bereits gemessenen Werte nach festen Zeitschritten im Intervall von 20 Tagen, beginnend am Tag 0 der Laktation. Durch Zwischenberechnung (Interpolation) eines Wertes, der zwischen 2 gemessenen Werten liegt, ergibt sich somit eine individuelle Laktationskurve (Milch, Fett, Eiweiß). Diese Laktationskurve spiegelt den gedachten Verlauf der Laktation dieses Tieres wieder unter Beachtung des Betriebsniveaus, des Alters und der Kalbesaison.
Daraus läßt sich ein Erwartungswert für Milch - kg, Fett - % und Eiweiß - % auf die kommende Milchleistungsprüfung ableiten (Formel 2).
yt = E(yt) + b1 * (xi – E(xi) ) + b2 * (Y305VL - E(Y305)VL ) )
wobei
yt = die vorauszusagende Milchleistung am Tag t der Laktation
E(yt) = die erwartete Milchleistung am Tag t der Laktation
xi = die letzte gemessene Milchleistung am Tag i der Laktation
E(xi) = die erwartete Milchleistung am Tag i in der Laktation
Y305VL = die 305-Tage-Leistung der vorigen Laktation
E(Y305VL) = die erwartete 305-Tage-Leistung in der vorigen Laktation
b1,b2 = Faktoren zur Voraussage
Dies besagt, das die vorauszusagende Milchleistung (Milch, Fett und Eiweiß) zum Zeitpunkt "t" der Laktation gleich ist mit der erwarteten Milchleistung zu diesem Zeitpunkt, zuzüglich einer gewogenen Differenz zwischen der letzten gemessenen Milchleistung und ihrer erwarteten plus einer gewogenen Differenz zwischen der berechneten 305 - Tage - Leistung der vorigen Laktation und ihrer erwarteten. Die Voraussagefaktoren b1 und b2 werden bestimmt pro Laktationstagsklasse ( Klassen mit einer Länge von 20 Tagen beginnend bei Tag 0), pro Merkmal (Milch, Fett, Eiweiß) und pro Laktationsnummer (1, 2, 3 und gößer 3)
Durch die Hinzunahme der vorigen Laktationsleistung wird eine genauere Voraussage getroffen.
7.1. Betriebsübersicht
Die neue Managementauswertung ist zweigeteilt in eine Betriebsübersicht und eine Einzeltierliste.
Die Abbildung 2 zeigt die betriebliche Übersicht sowie den Betriebsvergleich
Abbildung 2: Jahresübersicht Leistungsniveau und Betriebsvergleich

Über einen Zeitraum von 13 Monaten kann man den Verlauf der BSK - Werte grafisch vergleichen und Kurvenschwankungen leichter nachgehen.
Entscheidend ist auch die Darstellung der BSK-Linie von Tieren der 1. Laktation (Färsen). Sie sollte in jedem Fall über
der Herdenkurve liegen, da sie den Zuchtfortschritt repräsentiert.
Der Betriebsvergleich ermöglicht dem Landwirt, seine wichtigsten betrieblichen Parameter mit denen des Kreises und des Landes zu vergleichen.
7.2 Einzeltierliste
Die Einzeltierliste (Sortierschlüssel gibt der Landwirt vor) enthält alle wichtigen Leistungsdaten des Einzeltieres inklusive der hochgerechneten 305-Tage-Leistung und die Erwartungswerte für die nächste MLP ( Milch-kg, Fett-% und Eiweiß-%). Die Leistungsbewertung enthält die Parameter Zellzahlwert, Milchertrag(NE) und Laktationswert (Abbildung 3).
Abbildung 3: Einzeltierliste mit individuellen Leistungsparametern
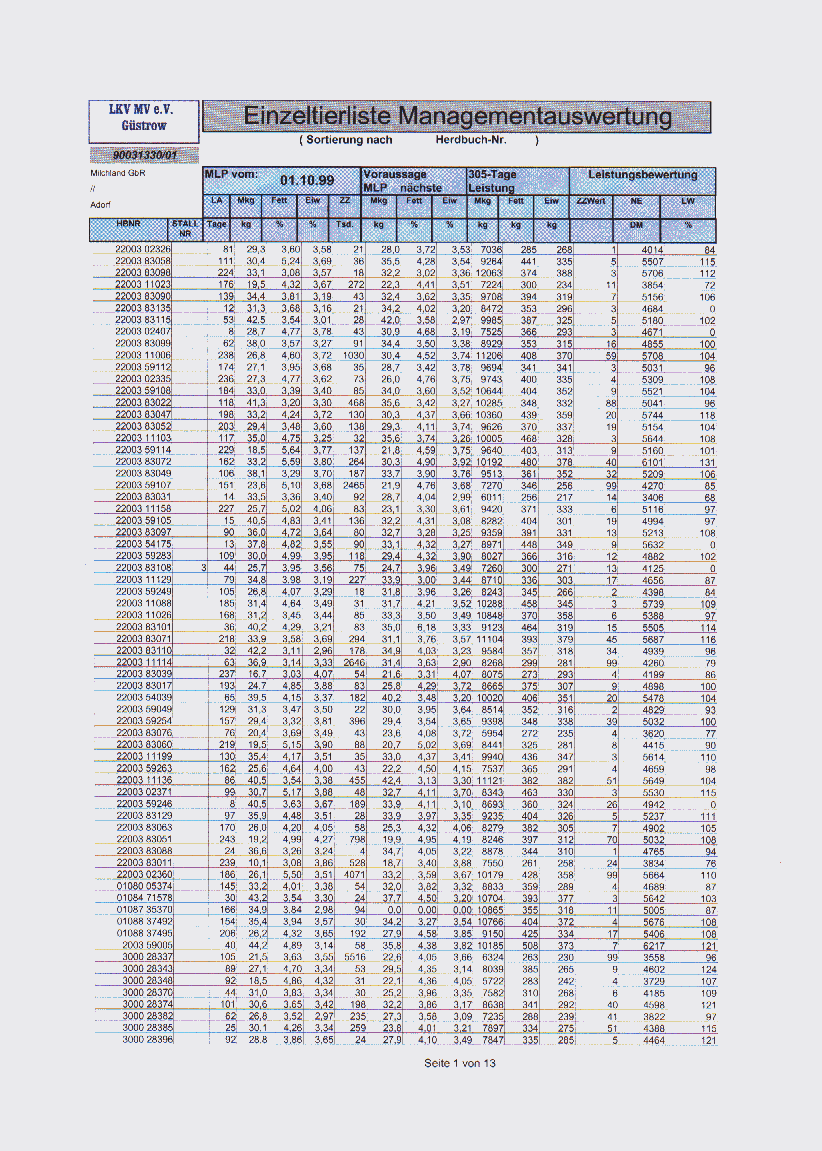
Wie ist mit dieser Liste zu verfahren ?
Sie gibt zunächst die Ergebnisse der letzten Milchleistungskontrolle wieder und die Voraussage der nächsten MLP. Die Voraussage bezieht sich immer auf einen Zeitraum von 4 Wochen (30 Tage). Bei kürzeren oder längeren Intervallen ist dies zu berücksichtigen.
Die hochgerechnete 305 - Tage - Leistung gibt einen Ausblick auf die zu erwartende Laktationsleistung.
Von der Leistungsbewertung ist die Kenngröße Zellzahlwert interessant, der die klinisch wichtigen Tiere mit Werten über 40 aufzeigt.
Der Milchertrag (NE), der bereits nach 2 Gemelken unter Berücksichtigung der Inhaltsstoffe (in Abhhängigkeit der jeweiligen Molkereipreise) den zu erwartenden finanziellen Ertrag in der Laktation berechnet, zeigt die eigentlichen Leistungsträger der Herde. Gepaart mit den Laktationswerten lassen sich die leistungsstärksten und - schwächsten Tiere gut erkennen. Dies ist besonders bei Erstkalbinnen von entscheidender züchterischer und ökonomischer Bedeutung. Tiere mit Laktationswerten unter 80 sind besonders kritisch zu betrachten; über einen Weiterverbleib in der Herde ist ernsthaft nachzudenken. Ideal ist ein Bestand, wenn die LW der Einzeltiere zwischen 90 und 110 liegen. Man kann dann von einer ausgeglichenen Herde sprechen, die wesentlich leichter zu managen ist (Fütterungsregime).
Tiere, die ihre erste Milchleistungskontrolle haben, bekommen noch keinen Laktationswert. Ebenso solche, die über 250 Laktationstage aufweisen.
Der BSK - Wert des Einzeltieres wurde in der Tierliste weggelassen, weil der Laktationswert eine höhere Aussage besitzt und mit ihm indirekt korrespondiert.
Ein Teil des Textes ist den Anwenderbeschreibungen der NRS " NRS Handboek – CR Delta" entnommen.